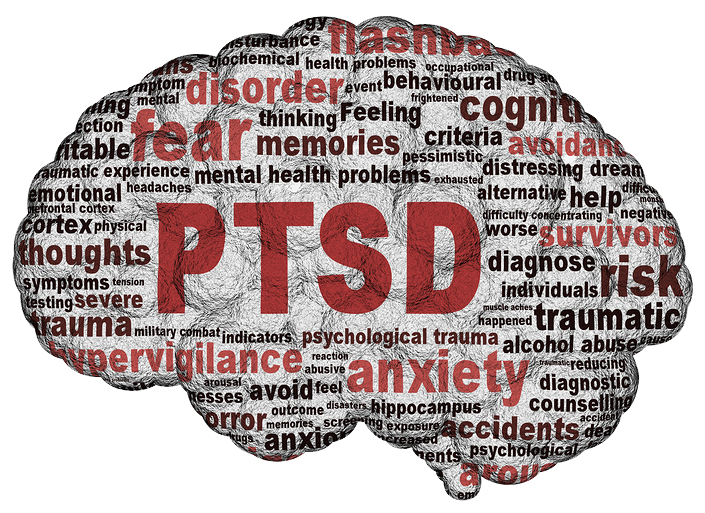Am 28. März 2019 hatte das Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee zu einem Symposium über Akute Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) eingeladen. Experten aus verschiedenen Bereichen berichteten über die Diagnostik und differenzierte Therapiemöglichkeiten:
Professor Dr. Dr. Andreas Maercker, Leiter des Psychologischen Instituts der Universität Zürich, betonte in seinem Eröffnungsvortrag zu Komorbiditäten psychischer und somatischer Störungen die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit von Somatik und Psychiatrie. Der Ordinarius stellte das PTBS-Symptombild mit intrusivem Wiedererleben, Vermeidung und Hypervigilanz, also erhöhter Wachsamkeit, ins Zentrum. Er verglich das Traumageschehen mit einem Blitzeinschlag in einen Baum. Sekundär bliebe, um welchen Blitz es sich handele, entscheidend sei, was mit dem Baum in der Folge geschehe. Zur Verhinderung chronischer Verläufe sei die Frühintervention unabdingbar, denn akut Traumatisierte konsultierten seltener das psychiatrisch-psychotherapeutische Fachgebiet.
PTBS am Arbeitsplatz
Dr. med. Christian Gravert, Leitender Arzt der Deutsche Bahn AG, referierte über PTBS am Arbeitsplatz. Der Mediziner stellte das Betreuungskonzept der Bahn vor, das präventive Maßnahmen, die Betreuung in der Akutphase vor Ort sowie die Nachbetreuung einschließt. Besondere Bedeutung habe die sofortige Betreuung durch Peers, also Kollegen mit vergleichbarem Erfahrungshintergrund. Die Berufswahl eines Triebfahrzeugführers berge das statistische Risiko, dass er zweimal in seinem Berufsleben mit dem Suizid eines Menschen konfrontiert werde. „Die Gesellschaft, die Presse und das Umfeld des Betroffenen haben großen Einfluss auf die Verarbeitung des traumatischen Ereignisses", sagte Gravert, der in diesem Zusammenhang auf Selbstvorwürfe und Schuldgefühle der Lokomotivführer verwies.
Regulationsmedizin in der Traumatherapie
Professor Dr. med. Robert Bering, Chefarzt des Zentrums für Psychotraumatologie der Alexianer Krefeld GmbH und Leiter des Alexianer-Institutes für Psychotraumatologie, beschäftigte sich mit der Frage, was die Regulationsmedizin für die Traumatherapie leiste. „Die Regulationsmedizin versucht die Ursachen körperlicher Fehlfunktionen zu erfassen und wieder zu regulieren", so Bering.Jeweils über 70 Prozent der Patienten mit PTBS gäben Schmerzen im Skelettbereich an. Die Myoreflextherapie, durch die die Selbstregulation mittels Druckpunktstimulation gefördert wird, führe zu einer Schmerzreduktion durch Absinken der Muskelspannung.
Behandlung von Geflüchteten
Dr. med. Ferdinand Haenel referierte über die psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung von Geflüchteten mit komplexen psychischen Traumafolgestörungen. Es handele sich um Betroffene, die neben kulturellen und sprachlichen Herausforderungen nicht selten durch einen unsicheren Aufenthaltsstatus belastet seien. Die Klienten litten neben PTBS unter komplexen psychiatrischen Störungsbildern. Die meisten von ihnen zeigten Scham, Misstrauen, Rückzug und Entfremdung. Im Sinne einer Beziehungsaufnahme seien die Behandler gefordert, individuelle Zugangswege zu finden.
Interkulturelle Online-Therapie
Professor Dr. phil. Christine Knaevelsrud, Wissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, berichtete über die interkulturelle Online-Traumatherapie. „Smartphones gehören zu den wichtigsten Gegenständen auf der Flucht", so Knaevelsrud. Dies und die zunehmende Bedeutung von Social Media lege Online Therapieformen nahe, die in einem breiten Spektrum verfügbar seien. Die Studienlage zeige Effektstärken, die mit konventionellen Therapien vergleichbar seien. Eine besondere Herausforderung stelle allerdings die kulturelle Adaption der Angebote dar. denn neben der Sprache seien unter anderem Metaphern und das methodische Vorgehen zu berücksichtigen. .
EMDR bei PTBS
Professor Dr. med. Meryam Schouler-Ocak, Professorin für Interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie in der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus, stellte die Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) als Methode zur Behandlung von PTBS vor. Auf Anamnese und Diagnostik folge die Stabilisierung, bevor mit der Traumaexposition, in deren Rahmen die Klienten ihre Traumata bearbeiteten, begonnen würde. Daran schlössen sich die Phasen der Trauer und Neuorientierung sowie die Verankerung, der Körpertest und der Abschluss an. Überprüft würden die Ergebnisse in der Folgesitzung. EMDR wirke konditionierend durch kontrollierte Wiederholungen. Entscheidend sei die bilaterale Stimulation der Gehirnhälften. Statt Fingerbewegungen könnten auch auditive Lichtbalken oder taktile Reize genutzt werden. „Auf der kognitiven Ebene können auf diese Weise dysfunktionale Ereignisse abgebaut werden", erklärte die Expertin.
Opferentschädigungsambulanz der Charité
Dr. med. Nikola Schoofs, Oberärztin der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus, stellte die Opferentschädigungsambulanz der Charité vor. Circa 60 Prozent der Menschen erlebten im Verlauf ihres Lebens ein traumatisches Ereignis, etwa zehn Prozent von ihnen entwickelten eine PTBS. „Ziel der Arbeit ist es, Risikopatienten zu identifizieren und präventiv tätig zu werden", so Schoofs. Symptome wie ein Hyperarousal, also die Übererregbarkeit des Nervensystems, das Wiedererleben des Traumas, ein Vermeidungsverhalten und dissoziative Störungen, also eine Realitätsentfremdung, seien richtungsweisend für eine PTBS. Die Ambulanz sei für Opfer oder Zeuge einer Gewalttat die erste Anlaufstelle. Zuweiser seien unter anderem die Polizei, der Weiße Ring, die Opferhilfe oder Gewaltschutzambulanzen. Klienten erhielten fünf bis 15 Sitzungen. In zwei Dritteln der Fälle reichten eine bis fünf Stunden aus. Die Weiterbetreuung erfolge durch teilstationäre oder ambulante Einrichtungen.